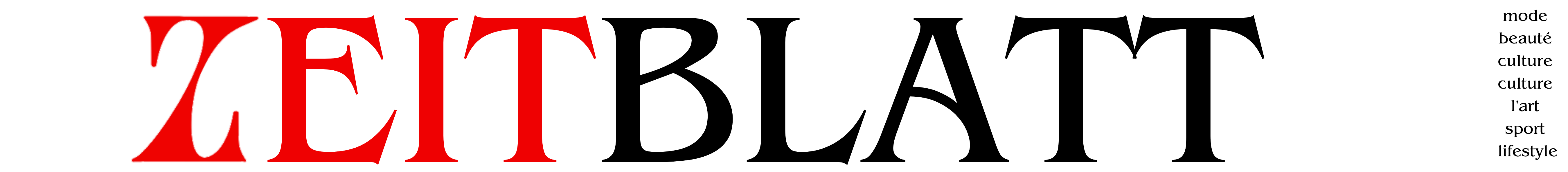Zucker, Zimmer und Fidels Erbe
Im ersten Halbjahr 2016 zählte Kuba 2,1 Millionen Touristen. Der sozialistische Staat hat seine Einnahmen im Tourismussektor um 15 Prozent auf 1,2 Mrd. US-Dollar steigern können, schreibt die kubanische Statistikbehörde ONEI in ihrer Publikation. 2017 kämpfte der Staat mit Hurricanes. Eigentlich sollte Havannas alter Hafen künftig auch touristischer Anlaufort für potentielle Fähren aus den USA werden. Darauf hatte sich Hostelbetreiber Enrique schon gefreut. Dank sozialer Medien finden nämlich ständig neue Touristen aus aller Welt zu ihm. Doch für amerikanische Backpacker sind die Errungenschaften Barack Obamas, die u. a. zu Erleichterungen im Tourismusbereich geführt haben, verloren. Denn seit November letztes Jahres sind nur noch organisierte Touren über amerikanische Firmen möglich. 2016 sind laut ZEIT Online rund 600.000 amerikanische Touristen nach Kuba gereist.
Zartrosanes Licht der letzten Sonnenstrahlen spiegelt sich auf denjenigen Wellen, die sich wie eine schnurrende Katze zu Füßen eines Fischermanns abrollen. Genau dort, wo auf Havannas Malecón – eine völlig zerfurchte acht Kilometer lange Uferpromenade entlang der schönsten Ruinen der Stadt – des Nachts das jugendliche Leben zum Reggaeton-ˇOffbeat tobt, sitzt im romantischen Mondschein ein Fischermann. Versteckt hinter der tanzenden Meute hält er vor der havannischen Promenade eine Angelrute in den stürmenden Golf von Mexiko. „Mit dem Nachtfischen versuchen sich so einige hier ein paar Pesos dazu zu verdienen“, sagt der Betreiber des Hostels Rolando’s Backpackers Enrique, das gleich ein paar Queerstraßen weiter in der Straße San Miguel im Herzen der Altstadt liegt. Das sei hier so eine Art Volkssport, aber auch ein Weg, an ein wenig Bargeld zu kommen, so der Ende 40-Jährige.

El Malecón

La Habana
Enrique trägt heute Bluejeans und Adidas zum blauen Polohemd – darauf aufgebügelt eine kubanische Flagge, die an den Sieg der Revolution 1959 erinnert. Sein europäischer Kleidungsstil unterscheidet sich sehr von dem grauen Fischermantel-Look – auch von dem anderer Habaneros. Jene tragen, was sie finden können; so scheint es. Kleidungsgeschäfte mit westlichen Marken gibt es in Havanna nicht. So sieht man kubanische Frauen häufig mit knall-bunten Longshirts und abgetragenen Leggins bekleidet die Calle San Miguel entlang schlendern.
Der gut-gelaunte Hostel-Besitzer kümmert sich neben der Verwaltung des Hostels um Ausflüge für Touristen wie Angel-Trips zur Insel Cayo Coco. Sein Gasthaus ist eine Art Treffpunkt für Backpacker geworden, die gerade irgendetwas brauchen oder einfach schwarze Bohnensuppe auf seiner sonnigen Dachterrasse genießen wollen.
Hier hat man auch eine sehr gute Aussicht über die Dächer La Habanas hinweg – bis hin zum Malecón. Das Hostel liegt im vierten Stock. Eine enge, steile Treppe führt dort hinauf. Von der Eingangstür aus gelangen Touristen entlang eines schmalen Gangs direkt zu Enriques Büro. In den Regalen türmen sich Reiseführer, Straßenkarten, Lexika sowie eine Menge anderer Bücher, auf seinem braunen Holzschreibtisch sammeln sich meterhoch Unterlagen. Die „Papierwirtschaft für dieses Hostel ist enorm aufwendig“, stöhnt er.
Enrique mag Flaggen. Sobald ein neuer Gast in eins der drei Mehr-ˇBettzimmer zieht, was meistens unangemeldet und spontan passiert, wird dessen Landesflagge im schmalen Flur gehisst. Stolz steigt er auf eine chinesische Flagge, die gleich neben einer norwegischen Fahne hängt. „Wir waren die ersten hier. Vor fünf Jahren war noch viel weniger los.“ Dabei blinzelt er mit großen braunen Augen über seine Lesebrille hinweg.„Aber niemand weiß, was jetzt passieren wird“, sagt Enrique über den Tod Fidel Castros und zuckt nachdenklich mit den Schultern.
Schon seit dreißig Jahren lebt Enrique zusammen mit seinen ständig wechselnden Gästen, seiner Frau Ludmilla und seiner 14-jährigen Tochter im Gasthaus.
Anders dürften sie nicht an Touristen vermieten. Das Zusammenleben mit den Touristen ist gesetzliche Vorschrift – und familiär. Die guten Rezensionen beim Portal Tripadvisor ziehen viele junge Leute her, die Preise und Enriques Service auch. Ein Mehrbettzimmer kostet neun Euro.
Camarones con Arroz
Zu Mittag kocht das Personal wie jeden Tag „Camarones con arroz y verduras“ für hungrige Touristen. Denn vier Euro für eine Portion Garnelen mit Reis und Gemüse kann sich ein kubanischer Durchschnittsverdiener nicht leisten. „Auf meinem Gehaltszettel stehen gerade mal 740 kubanische Pesos Monatslohn, was umgerechnet rund dreißig Euro sind“, rechnet ein Krankenpfleger auf einem verknüllten Papier vor, der als Nebentätigkeit Touristen zu Restaurants gegen eine Einladung zum Mittagessen führt. „Weil unser Lohn einfach nicht ausreicht, müssen wir uns etwas dazu verdienen. Da geht kein Weg dran vorbei“, bestätigt Enrique.
Seine Nachbarin besitzt das gleichnamige Tanzstudio San Miguel in der wohl schmutzigsten Straße von La Habana, wo sechs Touristenpaare ihre Hüften zu romantischen Salsa- und Rumba-Rhythmen schwingen.
Hin und wieder klettert Abgasdunst der in den Gassen verkehrenden Oldtimer den Balkon des schmucken Altbaus hoch und holt die Sinne der Tanzenden auf Kubas Straßen zurück. Die stinkende Calle San Miguel ist Teil des Unesco-Welterbes und zeigt so neben ihrer bröckelnden Fassade ihre karibische Lebensfreude: Konzerte im hoch gelobten Casa de la Música mit den wohl besten Salsa-Bands der Stadt sind hier ebenso Teil des Straßentreibens wie der Kunstmarkt und Wandmalereien zur Geschichte Havannas im ersten Gasthaus der Altstadt.

Sexy Girl in der Straße: Calle San Miguel
Fischer kämpfen um ihre Existenz
Während der Hostelbetreiber für seine Gäste aus China, Europa und neuerdings sogar aus den USA für ein paar Euro extra Ausflüge organisiert und im Hostel verköstigt, verkaufen einige Kubaner Zwiebeln aus dem Umland mit ein paar Cents Gewinn an die Hauptstädter weiter. Die ärmsten Fischer sammeln sogar Krebstiere im Meeres-Abwasser-Gemisch an Havannas Küste. Tag oder Nacht – es herrscht ständig geschäftiges Treiben, obwohl das lange nicht legal war. „Selbst Kuchen auf der Straße zu verkaufen, ist erst seit zwei Jahren erlaubt“, lacht Enrique, der sich an blonden Frauen mit blauen Augen nicht sattsehen kann. „Aber wir sind wie kubanischer Zucker. Wir sind süß und lieben das Leben.“ „Somos Cubanos“ – „wir sind eben Kubaner“. Damit meint der Mitte 40-Jährige wohl die bislang ungebrochene Überlebenskunst des Volkes.
Experte Whittle fördert nachhaltiges Fischen
Über die kann auch Kuba-Experte Daniel Whittle immer noch staunen. Obwohl der Amerikaner schon seit dreißig Jahren in Kuba vor Ort mit Wissenschaftlern der Universität von Havanna zusammenarbeitet, hält er die kubanische Überlebensart für etwas Besonderes. „Wir schauen uns auch die Armut der Leute an, damit wir sie in unsere nachhaltigen Fischprojekte integrieren können“, führt Whittle an.
So ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wie die Tourismusförderung nicht nur für Hostelbetreiber wichtig. Der Marine-Experte und Direktor des Environmental Defense Fund (EDF) – einer Umweltorganisation mit Sitz in New York – hält die nachhaltige Entwicklung des Landes gerade für Fischer essenziell. 60 Prozent der Fischbestände seien schon in einem kritischen Zustand. Und erst seit zwei Jahren – dank der Annäherungspolitik von Ex-Präsident Obama und Kubas Raúl Castro – gebe es wieder Hoffnung für die wirtschaftliche Entwicklung des Insel-Staates. „Mehr Tourismus bedeutet, man kann mehr Jobs durch Tour Guiding schaffen, sagt der Wissenschaftler optimistisch.

Typische kubanische Mahlzeit für Touristen
„Den Lebensstandard zu verbessern, das passiert durch Nachhaltigkeit – durch verantwortungsbewussten Ackerbau und nachhaltiges Fischen. Und das wissen viele Kubaner“, behauptet der Marine-Experte. Zudem steht in der staatlichen Verfassung Kubas in Artikel 27 von 1992: „Der Staat schützt die Umwelt und die natürlichen Ressourcen des Landes. Doch diese Maßnahme hat Havannas Fischer bislang noch nicht erreicht. Aber auch sie werden Havannas Geschichte am Malecón mitschreiben.
El Malecón hat Ludmilla erst vor ein paar Tagen auf die Wand der Hostel-Dachterrasse gepinselt. Er ist Treffpunkt, politisches Schaubild, touristischer Magnet – das Sinnbild der Stadt.
Ludmillas Bild zeigt den Blick zur Festung Castillo de los Reyes del Morro auf lichtblauem Hintergrund. Täglich um 21.00 Uhr ertönt dort ein lauter Knall. Doch die Stadttore schließen nicht mehr. Diese Zeiten sind längst vorbei. Havannas Jugend fischt auch nicht mehr. Sie ertränkt ihre Sorgen mit Rum aus Tetrapacks und übertönt das Meeresrauschen mit monotonem Reggaeton.